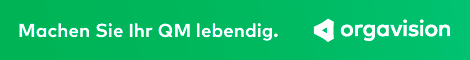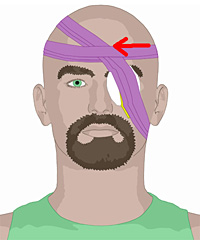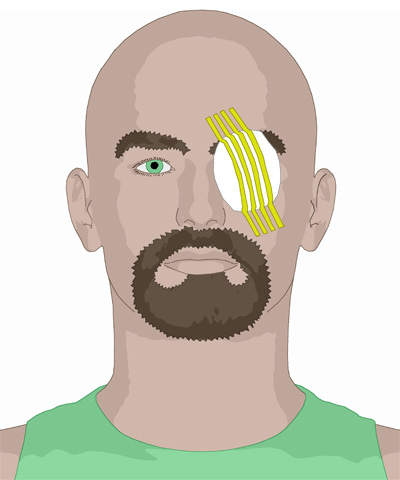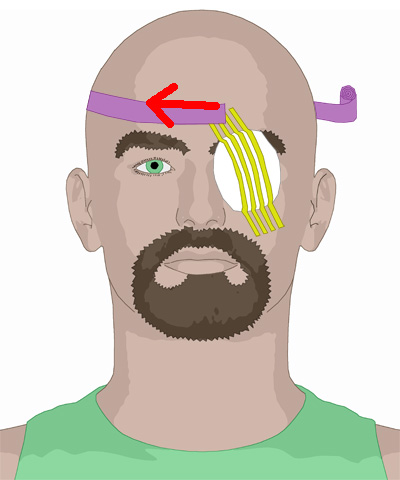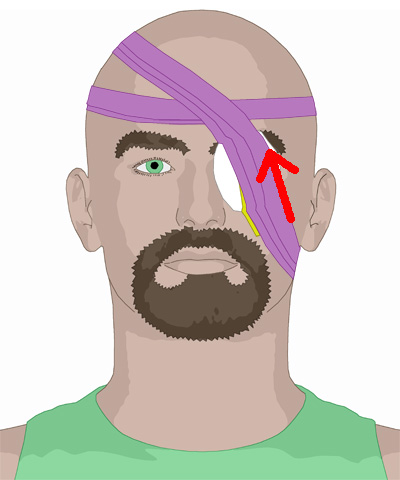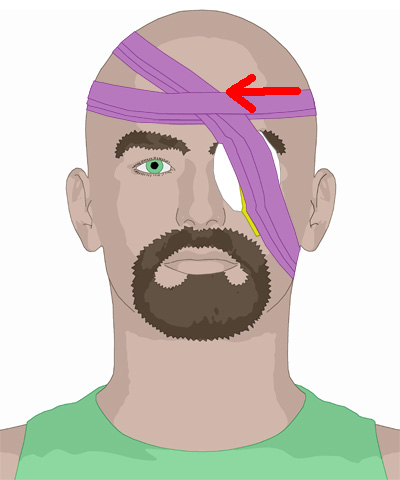|
|
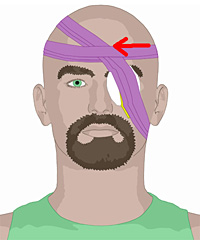 |
|
Version 2.05a - 2015 |
|
Standard "Augenverband" |
|
|
|
Augen
reagieren vor allem nach operativen Eingriffen empfindlich selbst auf
kleine Hygienemängel. Entsprechend umsichtig muss der Wechsel eines
Verbandes erfolgen. Ein guter Standard schafft daher die Grundlagen für
eine rasche und komplikationsfreie Ausheilung. |
|
|
|
Wichtige Hinweise:
- Zweck unseres Musters ist es nicht,
unverändert in das QM-Handbuch kopiert zu werden. Dieser
Pflegestandard muss in einem Qualitätszirkel diskutiert und
an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.
- Unverzichtbar ist immer auch eine
inhaltliche Beteiligung der jeweiligen Haus- und Fachärzte,
da einzelne Maßnahmen vom Arzt angeordnet werden müssen.
Außerdem sind etwa einige Maßnahmen bei bestimmten
Krankheitsbildern kontraindiziert.
- Dieser Standard eignet sich für die
ambulante und stationäre Pflege. Einzelne Begriffe müssen
jedoch ggf. ausgewechselt werden, etwa "Bewohner" gegen
"Patient".
Dieses Dokument ist auch
als Word-Dokument (doc-Format) verfügbar.
Klicken Sie hier!

|
| |
|
Standard "Augenverband" |
| Definition: |
- Augenverbände werden angelegt, um Wundauflagen
zu fixieren oder um das Auge ruhigzustellen. Die Wahl der Verbandsform
erfolgt durch den Arzt in Form einer Verordnung.
|
| Grundsätze: |
- Wir sind uns stets bewusst, dass das Augensekret infektiös sein könnte.
- Das Auge ist ein sehr empfindlicher
Körperbereich. Es besteht bei allen Pflegemaßnahmen eine erhöhte
Verletzungs- und Infektionsgefahr. Es wird daher stets sanft und
behutsam gearbeitet.
- Der Verbandswechsel wird von vielen Bewohnern als unangenehm empfunden. Wir müssen daher stets einfühlsam vorgehen.
- Alle Materialien, die mit dem Auge in Kontakt kommen, müssen steril sein. Alle übrigen Materialien sind zumindest keimarm.
|
| Ziele: |
- Die Heilung der Augen wird gefördert.
- Krankhafte Veränderungen sowie Heilungsverzögerungen werden zeitnah erkannt.
- Infektionen werden vermieden.
- Die Schmerzbelastung des Bewohners wird auf ein Minimum reduziert.
|
| Vorbereitung: |
Material
|
Wir stellen das notwendige Material bereit:
- Kompressen
- Verbandsschere
- 0,9%ige Kochsalzlösung
- Augenklappe, sterile Augenkompresse
- sterile Tupfer
- hautfreundliches Pflaster
- Einmalhandschuhe
- Nierenschale
|
Organisation
|
- Wir kontaktieren den behandelnden Arzt bzw.
Augenarzt. Wir lassen uns alle relevanten Informationen geben. Sofern
dieser die Anweisungen nicht schriftlich darlegen möchte, erfolgt die
Einweisung telefonisch. Wir halten die ärztlichen Vorgaben in der
Pflegedokumentation fest. Es gilt dabei das Prinzip "v.u.g."
("vorgelesen und genehmigt").
- Die Pflegefachkraft führt eine hygienische Händedesinfektion durch und zieht die Einmalhandschuhe an.
- Der Bewohner wird über die anstehende Maßnahme
informiert und um Zustimmung gebeten. Auch bewusstlose Bewohner werden
informiert.
- Die Pflegefachkraft bringt den Oberkörper des
Bewohners in eine leicht erhöhte Lage. Ggf. wird dafür das Kopfstück
des Bettes nach oben gefahren.
- Bei liegenden Bewohnern wird der Kopf leicht in
Richtung Pflegekraft geneigt. Nach Möglichkeit wird der Verbandswechsel
jedoch im Sitzen durchgeführt. Ideal ist es, wenn der Bewohner seinen
Kopf an einem festen Gegenstand oder an einer Wand anlehnen kann. Der
Kopf ist dann beim Verbandswechsel sehr ruhig.
- Die Pflegefachkraft fährt das Bett in eine angenehme Arbeitshöhe.
- Eine ggf. vorhandene Brille wird auf dem
Nachttisch abgelegt. Die Brille wird stets auf den Bügeln gelagert, um
das Risiko von Beschädigungen des Glases zu reduzieren.
|
| Durchführung: |
Wechsel des Verbandes
|
(Hinweis: Die Vorgehensweise kann je nach verwendetem Augenverband variieren.)
- Die Pflegekraft löst vorsichtig die Augenklappe
und den alten Verband. Um die empfindliche Gesichtshaut zu schützen,
fixiert die Pflegekraft die Haut am Pflasterrand und erzeugt eine
moderate Gegenspannung. Die Pflegekraft sollte also nicht am Verband
zerren.
- Die Pflegekraft bittet den Bewohner, die Augen
zu schließen. Sie feuchtet die Kompressen mit der Kochsalzlösung an und
reinigt das Auge äußerlich. Sekret, Ablagerungen sowie Salbenreste
werden entfernt. Die Wischrichtung erfolgt in Richtung
Augeninnenwinkel. Die Pflegekraft übt dabei keinen Druck auf das Auge
aus. Nicht entferntes Sekret ist ein idealer Nährboden für Keime.
- Die Pflegekraft achtet auf Anzeichen für eine sich entwickelnde Infektion; insbesondere auf Rötungen.
- Die Pflegekraft legt die sterile Augenkompresse
auf das Auge auf. Die dem Auge zugewandte Seite muss steril bleiben und
darf nicht berührt werden. Der Bewohner wird ggf. gebeten, den Verband
festzuhalten. Eine ggf. in der Augenkompresse vorhandene Naht muss nach
außen weisen.
- Mit zwei bis drei Plasterstreifen fixiert die Pflegekraft die Kompresse samt Augenklappe.
- Die Pflegekraft stellt sicher, dass die
Lidspalte unter dem Verband geschlossen bleibt. Sie prüft auch, ob sich
der Verband bei Kaumuskelbewegungen oder bei Mimikbewegungen ablöst.
- Die Pflegekraft erkundigt sich beim Bewohner,
ob der Verband unangenehm ist. Der Bewohner wird ermuntert, sich bei
Schmerzen umgehend bei einer Pflegekraft zu melden.
Anlegen eines Druckverbands mit einer elastischen Binde:
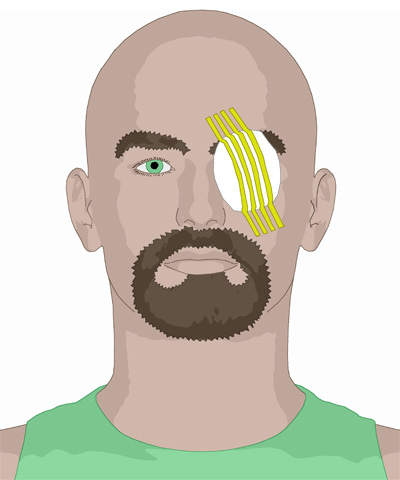
1. Schritt
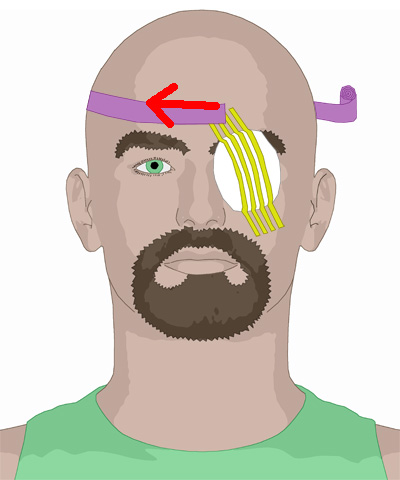
2. Schritt
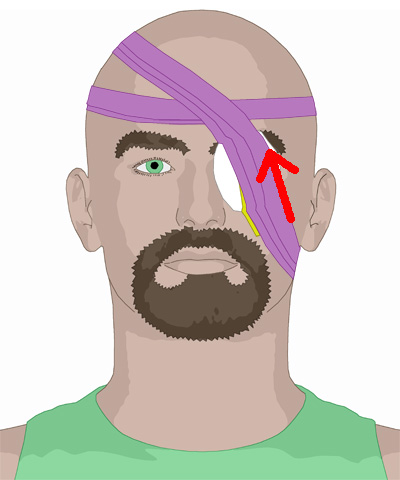
3. Schritt
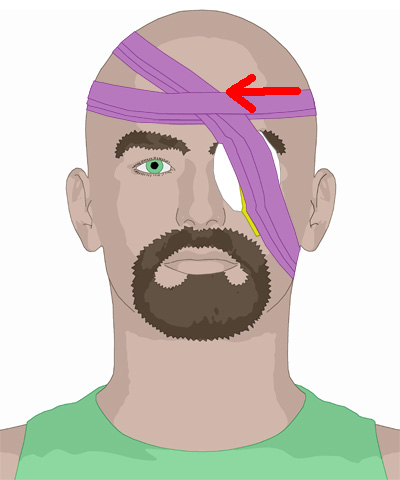
4. Schritt
|
Verbandsformen
|
Je
nach Schädigung des Auges werden verschiedene Verbände genutzt. Die
Entscheidung, welcher Verband verwendet wird, trifft der Arzt.
- Einfacher Augenverband: Hierbei handelt es sich
um eine ovale Augenkompresse, die mit 2 bis 3 Pflasterstreifen
befestigt wird. Die Pflaster werden parallel zum Nasenflügel von oben
nach unten angebracht. Eine ggf. vorhandene Brille kann am Tag über dem
Verband getragen werden. In der Nacht sorgt ggf. eine Augenklappe für
den notwendigen Schutz des Auges. Ein solcher Verband schützt
insbesondere vor Infektionen und wird z.B. nach Netzhautoperationen
angelegt.
- Uhrglasverband: Eine transparente
Plexiglaskappe wird mit den bereits vorgefertigten Haftstreifen über
dem Auge fixiert. Da der Verband das Auge wie eine Glocke luftdicht
abschließt, beschlägt das Glas. Es bildet sich eine feuchte Kammer.
Gleichzeitig wird der Bereich vor dem Eindringen von Fremdkörpern sowie
vor Druckeinwirkung geschützt. Dieser Verband wird etwa bei fehlendem
oder bei unvollkommenem Lidschluss genutzt, um das Auge vor dem
Austrocknen zu schützen.
- Druckverband: Mehrere Schichten aus
übereinandergelegten Kompressen werden mit Pflasterstreifen oder mit
einer elastischen Binde über dem Wundbereich fixiert. Alternativ kann
auch ein Pflaumentupfer genutzt werden. In den ersten beiden Tagen nach
einem operativen Eingriff (etwa einer Enukleation / Ausschälung des
Auges) können mit diesem Verband Nachblutungen vermieden werden. Er
wird vom Arzt entfernt.
- Hohlverband: Es handelt sich hierbei um eine
Kunststoffsiebplatte, die direkt (also ohne eine weitere Kompresse)
über dem Auge aufgebracht wird. Notwendig ist dieser Verband z.B., wenn
das Auge nach einer Hornhautübertragung vor Druck, vor Zugluft und vor
Infektionen geschützt werden muss. Die Löcher ermöglichen es dem
Betroffenen, sich zumindest teilweise visuell zu orientieren.
- Salbenverband: Dieser Verband soll aufgetragene
Salben möglichst lange am Auge halten und einwirken lassen. Nachdem die
Salbe in den unteren Bindehautsack eingebracht wurde, legt der Arzt /
die Pflegekraft die Kompresse auf und fixiert diese per Siebklappe.
Notwendig ist dieser Verband etwa nach operativen Eingriffen im Rahmen
der Therapie von altersabhängiger Makuladegeneration.
- Binokulus: Es handelt sich um einen
beidseitigen Augenverband, der eine absolute Ruhigstellung des
geschädigten Auges sicherstellen soll. Wenn nur ein Auge mit einem
Verband versorgt wird, wird dieses den Bewegungen und den
Pupillenreaktionen des sehenden Auges folgen. Es werden daher beide
Augen geschlossen und mit Kompressen verdeckt. Alternativ können für
die Fixierung Binden genutzt werden, die in Kreistouren vom Nacken über
die Augenbrauen und Augen unter den Ohren und zurück zum Nacken geführt
werden ("Rollverband").
(Hinweis: Ein beidseitiger Augenverband sollte nur dann genutzt werden,
wenn ein einseitiger Verband nicht ausreichend ist. Der totale Verlust
der Sehfähigkeit stellt für Bewohner eine enorme Einschränkung der
Lebensqualität dar. Überdies steigt das Risiko von Stürzen und
Unfällen.)
|
Hinweise
|
- Wenn der Bewohner durch den Verband vollständig
oder weitgehend seiner visuellen Fähigkeiten beraubt wird, reagieren
viele mit Hilflosigkeit und Angstzuständen. Dieses insbesondere bei
gleichzeitigen demenziellen Erkrankungen. Wir wirken dann beruhigend
auf den Bewohner ein.
- Wir achten darauf, dass der Bewohner alle
notwendigen Gegenstände (Getränke, Rufanlage usw.) in direkter
Griffweite findet. Wir beschreiben dem Bewohner, wo diese liegen.
- Wir stellen sicher, dass Wertgegenstände ggf.
gesichert werden. Der Bewohner soll sich während des temporären
Verlustes der Sehfähigkeit keine Sorgen wegen etwaiger Diebstähle
machen müssen. Diese Maßnahme erfolgt grundsätzlich unter Zeugen.
- Wenn ein Augenverband längere Zeit getragen
werden muss, sollte ein Weg gefunden werden, um dennoch die Haare
waschen zu können. Wir kontaktieren dafür ggf. erneut den Augenarzt.
|
| Nachbereitung: |
- Die verwendeten Hilfsmittel werden entsorgt bzw. gesäubert und desinfiziert.
- Bei Problemen wird der behandelnde Augenarzt informiert und ggf. ein Termin vereinbart.
- Die Pflegekraft führt eine hygienische Händedesinfektion durch.
- Dem Bewohner wird ggf. die Brille wieder aufgesetzt.
- Der Bewohner wird befragt, ob er weitere Wünsche hat. Bei der Gelegenheit kann ihm ein Getränk angeboten werden.
- Alle Maßnahmen werden umfassend dokumentiert.
- Nach einiger Zeit kontrollieren wir noch einmal
den korrekten Sitz des Verbandes. Insbesondere kann ein Verband zu
locker sein und sich lösen.
- Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.
|
| Dokumente: |
- Leistungsnachweise "medizinische Pflege"
- Pflegebericht
- Pflegeplanung
- Bogen: Fragen an den Arzt
|
| Verantwortlichkeit / Qualifikation: |
|
|
| |
| |
|
| |
| |
|
Weitere Informationen
zu diesem Thema |
|
|
|
|
Schlüsselwörter für diese Seite |
Auge; Augentropfen; Augensalbe; Wunde;
Augenverband; Verband |
|
| Genereller
Hinweis zur Nutzung des Magazins: Zweck unserer Muster und
Textvorlagen ist es nicht, unverändert in das QM-Handbuch
kopiert zu werden. Alle Muster müssen in einem Qualitätszirkel
diskutiert und an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.
Unverzichtbar ist häufig auch eine inhaltliche Beteiligung der
jeweiligen Haus- und Fachärzte, da einzelne Maßnahmen vom Arzt
angeordnet werden müssen. Außerdem sind etwa einige Maßnahmen
bei bestimmten Krankheitsbildern kontraindiziert. |
|