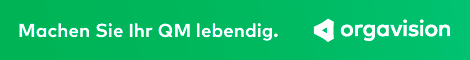|
|
 |
|
Version 2.05 - 2016 |
|
Standard "Pflege von blinden und
stark sehbehinderten Senioren" |
|
|
|
90 Prozent aller Informationen über seine Umwelt gewinnt
der Mensch über die Augen. Entsprechend große Einschränkungen bringt
eine Blindheit oder eine starke Sehbehinderung mit sich. Die Pflege von
Betroffenen ist anspruchsvoll und sollte daher für das QM-Handbuch
schriftlich fixiert werden. |
|
|
|
Wichtige Hinweise:
- Zweck unseres Musters ist es nicht,
unverändert in das QM-Handbuch kopiert zu werden. Dieser
Pflegestandard muss in einem Qualitätszirkel diskutiert und
an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.
- Unverzichtbar ist immer auch eine
inhaltliche Beteiligung der jeweiligen Haus- und Fachärzte,
da einzelne Maßnahmen vom Arzt angeordnet werden müssen.
Außerdem sind etwa einige Maßnahmen bei bestimmten
Krankheitsbildern kontraindiziert.
- Dieser Standard eignet sich für die
ambulante und stationäre Pflege. Einzelne Begriffe müssen
jedoch ggf. ausgewechselt werden, etwa "Bewohner" gegen
"Patient".
Dieses Dokument ist auch
als Word-Dokument (doc-Format) verfügbar.
Klicken Sie hier!

|
| |
|
Standard "Pflege von blinden
und stark sehbehinderten Senioren" |
| Definition:
|
- Totale Blindheit (Amaurose) ist ein Fehlen des
Sehvermögens, das entweder angeboren ist oder erworben wurde.
- Als "blind" werden auch Menschen bezeichnet,
die unter einer so starken Sehschwäche oder Gesichtsfeldeinschränkung
leiden, dass sie sich in unvertrauter Umgebung nicht zurechtfinden
können. Eine Blindheit liegt vor, wenn die Sehstärke auf dem besseren
Auge auf zwei Prozent des Normalwerts gesunken ist oder andere
Störungen vorliegen, die dauerhaft die Sehstärke auf 2 Prozent oder
weniger senken. In solchen Fällen sind Betroffene nur noch in der Lage,
hell und dunkel zu unterscheiden.
- Die wichtigsten Ursachen für Blindheit sind
Schädigungen der Netzhaut, Erkrankungen des Sehnervs, Glaukom ("grüner
Star"), Retinopathia diabetica, Katarakt ("grauer Star") sowie
Beschädigungen des Sehzentrums im Hirn etwa als Folge von
Durchblutungsstörungen, Tumoren oder entzündlichen Prozessen.
|
| Grundsätze:
|
- Es ist uns bewusst, dass insbesondere eine
frisch eingetretene Blindheit zu Zorn, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit
und Aggressivität führen kann. Wir lassen diese Gefühle soweit möglich
zu.
- Alle Tätigkeiten, die ein sehbehinderter oder
blinder Bewohner selbstständig oder mit Unterstützung erledigen kann,
sollten nicht voreilig von den Pflegekräften übernommen werden.
- Sehbehinderte oder blinde Bewohner haben das
Recht auf vollständige Teilhabe am sozialen Leben. Der Kontakt mit
sehenden Bewohnern wird von uns nach Kräften gefördert.
- Sehbehinderte oder blinde Bewohner haben das
Recht auf eine umfasende Versorgung mit technischen Hilfsmitteln.
|
| Ziele:
|
- Der Bewohner wird vor Isolation und vor
Einsamkeit geschützt.
- Verbliebene Sehfähigkeiten werden gefördert.
- Der Bewohner erhält die bestmögliche
medizinische Betreuung und eine gute Versorgung mit Hilfsmitteln.
- Die Sicherheit des Bewohners ist gewährleistet,
insbesondere im Straßenverkehr. Der Bewohner stürzt nicht.
- Der Bewohner wird mit der Lebenskrise, die eine
unlängst erfolgte Blindheit auslöst, nicht allein gelassen.
|
| Vorbereitung: |
- Pflegekräfte sind aufgefordert, sich mit
Selbstexperimenten in die Lage des Bewohners einzufühlen, sich also
etwa mit geschlossenen Augen von einem Kollegen führen zu lassen.
- Betroffene Bewohner erhalten eine geschulte und
erfahrene Bezugspflegekraft. Diese sollte nach Möglichkeit nicht
wechseln.
|
| Durchführung:
|
Kommunikation
|
- Bei Begegnungen auf dem Flur oder in
Gemeinschaftsräumen nennt die Pflegekraft stets ihren Namen.
- Beim
Betreten des Zimmers stellt sich die
Pflegekraft mit Namen vor und erklärt den Zweck ihres Besuchs. Auch
Mitbewohner werden gebeten, im Kontakt mit dem erblindeten Senioren
stets einleitend ihren Namen zu nennen. Bei schon langjährig
Erblindeten kann ggf. darauf verzichtet werden, da er die verschiedenen
Pflegepersonen schon am Gang erkennt.
- Der Bewohner wird immer mit seinem Namen
begrüßt. Er weiß dann, dass er (und keine andere Person) angesprochen
wurde.
- Während des Aufenthalts im Zimmer beschreibt
die Pflegekraft, welche Tätigkeiten sie aktuell durchführt.
- Wenn die Pflegekraft das Zimmer verlässt,
informiert sie zuvor den Bewohner darüber.
- Auf Wunsch erhält der Blinde die Möglichkeit,
das Gesicht der Pflegekraft abzutasten, um sich ein Bild von seinem
Gegenüber machen zu können.
- Pflegekräfte müssen sich bewusst sein, dass
Blinde den nonverbalen Teil der Kommunikation (Mimik, Gestik usw.)
nicht erkennen und erfassen können.
- Alle Erklärungen sollten möglichst konkret und
sachlich erfolgen, etwa: "Ihre Brille liegt auf dem Tisch gleich rechts
neben Ihrer Pfeife und dem Tabak."
- Hinweise wie "hier", "da" oder "dort" sind für
Betroffene wertlos, da sie die richtungsweisende Geste nicht sehen
können.
|
Gestaltung der Umwelt
|
- Beim Heimeinzug wird der Bewohner in sein
Zimmer begleitet. Die Pflegekraft erklärt dem Bewohner die Funktion
aller hier befindlichen Gegenstände. Der Bewohner erhält ausreichend
Zeit, sich per Fühlen und Ertasten mit jedem Objekt vertraut zu machen.
Im Badezimmer erklärt die Pflegekraft etwa, wo sich die
Toilettenspülung und das Toilettenpapier befinden. Besonders wichtig
ist es, den Bewohner in die Rufanlage einzuweisen.
- So zeitnah wie möglich wird der Bewohner durch
die Einrichtung geführt. Er lernt den Speiseraum und seinen Sitzplatz
kennen, sowie den Raum für die Beschäftigungsangebote und weitere
Gemeinschaftsräume. Dabei werden ihm die Besonderheiten auf den Wegen
oder in den Räumen genau erklärt.
- Das persönliche Ordnungssystem des Bewohners im
Zimmer wird beachtet, auch wenn es auf die Pflegekräfte konfus wirkt.
Ohne vorherige Absprache mit dem Bewohner werden keine Veränderungen im
Zimmer vorgenommen. Dazu zählt das Verrücken von Möbeln ebenso wie die
Änderung der Position von wichtigen Gegenständen. Auf diese Vorgabe
machen wir insbesondere auch die Reinigungskräfte aufmerksam.
- Generell sollte auf Hindernisse und auf
Gegenstände geachtet werden, über die der Bewohner stolpern könnte.
Wichtig ist insbesondere ein kurzer und unverstellter Weg zum
Badezimmer.
- Zerbrechliche Gegenstände können, auf Wunsch des Bewohners, mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden.
- Treppenabsätze, Geländer und Haltegriffe werden
mit kontrastreichen Farben versehen. Ggf. können die erste und die
letzte Treppenstufe fühlbar gemacht werden.
- Wir achten auf eine gute Beleuchtung.
- Die Zimmertür des Bewohners wird mit einem
eindeutig fühlbaren Symbol oder mit der fühlbaren Zimmernummer
gekennzeichnet.
- Zimmertüren werden entweder geöffnet oder
geschlossen. Halb offene Türen sind ein Kollisionsrisiko.
- Schranktüren werden ebenfalls immer wieder
geschlossen.
- Bei sich automatisch öffnenden Türen erklärt
die Pflegekraft, in welche Richtung sie sich jeweils öffnet und
schließt und welcher Abstand eingehalten werden muss.
- Wir setzten uns mit der Haustechnik zusammen, um diese Dinge umzusetzen.
|
Hilfsmittel
|
- Wenn der Bewohner das Haus verlässt, statten
wir ihn mit einem weißen Stock und der gelben Armbinde mit drei
schwarzen Punkten aus, sofern er dieses wünscht.
- Wir prüfen, ob ein Blindenführhund notwendig
ist und beantragt werden sollte.
- Wir testen, ob der Bewohner eine
computergestützte Lesehilfe benötigt. Diese kann auf Kosten der
Krankenkasse ausgeliehen werden. Alternativ kann der Einsatz von Lupen
oder Prismenfernrohrbrillen sinnvoll sein.
- Wir beraten und übernehmen auf Wunsch die Beantragung von Hilfsmitteln bei der Krankenkasse.
- Wir stellen den Kontakt zur Arbeitsgemeinschaft
der Blindenhörbüchereien her. Auf Wunsch kann der Betroffene von dort
verschiedene literarische Werke als Hörbuch beziehen. Bei
Sehbehinderten prüfen wir, ob Bücher im Großdruck für den Betroffenen
interessant sein könnten.
- Wir halten ggf. Bücher und Zeitschriften in
Brailleschrift bereit.
- Ggf. statten wir den Bewohner mit einer Uhr zum
Ertasten aus. Viele Geräte können mittlerweile auch "sprechen".
- Die Brille eines Sehbehinderten sollte immer
sauber und griffbereit sein.
|
soziale Kontakte
|
- Wir stehen dem Bewohner jederzeit für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung. Insbesondere, wenn die Erblindung
erst vor kurzer Zeit eintrat, ist menschliche Zuwendung sehr wichtig.
- Wir beraten den Bewohner, der gerade erblindet ist, gerne zu den Themen Blindengeld und Behindertenausweis.
- In unseren Freizeiträumen halten wir auch
Brett- und Gesellschaftsspiele für Blinde bereit. Wenn wir mit dem
Blinden den Raum betreten, benennen wir alle anwesenden Personen und
erklären, was sie gerade machen.
- Bei Veranstaltungen im Haus ist es hilfreich,
wenn wir dem Bewohner ab und zu vermitteln, was gerade geschieht und
wie es aussieht.
- Wir stellen ggf. den Kontakt zu
Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen her.
- Wir ziehen einen Ergotherapeuten heran. Dieser kann mit dem Bewohner ein Alltagstraining durchführen.
- Wir regen an, Kontakte zu Freunden und zu
Verwandten weiter zu pflegen.
- Wir ermutigen den Bewohner, Sportarten
auszuüben, die seinem individuellen Restsehvermögen angepasst sind.
- Wir prüfen, ob in unserer Stadt ein
ehrenamtlicher Vorleser verfügbar ist.
- Wir machen den Bewohner mit den neuen
elektronischen Medien vertraut, etwa mit einem MP3-Player.
- Wir ermutigen und beraten den Bewohner zur selbständigen Auswahl des Radio- und / oder Internetangebots.
|
Vorlesen der Post
|
- Briefe werden dem Bewohner ungeöffnet
übergeben. Die Pflegekraft nennt lediglich den Absender des Briefs. Der
Pflegebedürftige kann selbst entscheiden, welche Pflegekraft oder
welcher Angehörige das Vorlesen übernehmen soll.
- Die Pflegekraft liest langsam und deutlich.
- Kommentare zum Gelesenen sind zu unterlassen.
- Der Inhalt des vorgelesenen Briefs ist streng
vertraulich.
+++ Gekürzte Version. Das komplette Dokument finden Sie hier. +++ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| |
| |
|
Weitere Informationen
zu diesem Thema |
|
|
|
|
Schlüsselwörter für diese Seite |
Blindheit; Sehbehinderung; Erblindung; Auge |
|
| Genereller
Hinweis zur Nutzung des Magazins: Zweck unserer Muster und
Textvorlagen ist es nicht, unverändert in das QM-Handbuch
kopiert zu werden. Alle Muster müssen in einem Qualitätszirkel
diskutiert und an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.
Unverzichtbar ist häufig auch eine inhaltliche Beteiligung der
jeweiligen Haus- und Fachärzte, da einzelne Maßnahmen vom Arzt
angeordnet werden müssen. Außerdem sind etwa einige Maßnahmen
bei bestimmten Krankheitsbildern kontraindiziert. |
|